Raphael M. Bonelli
Der Glaube auf der Couch
Der Glaube auf der Couch
»Gott ist tot«, postulierte Friedrich Nietzsche vor mehr als 100 Jahren. Die Kirche ist anscheinend out – und sündigen kann man heute nur noch mit einem zu großen Stück Schokotorte. Warum dennoch so viele junge Menschen gegen diese 68er-Weisheiten Sturm laufen, warum ihr Glaube sie glücklich macht, warum sie von Atheisten beneidet werden, erklärt der Wiener Psychiater Raphael M. Bonelli.
Doch in diesem leicht verständlichen Buch legt sich nicht nur der Glaube auf die Couch. Hier wird auch dargelegt, warum jeder Fußballer nur mit Gehorsam erfolgreich wird, warum James Bond weder zur Ehe noch zum Zölibat fähig ist und dass bereits die alten Griechen wussten, wie der Mensch glücklich wird: Die Tugenden kehren zurück.
Doch in diesem leicht verständlichen Buch legt sich nicht nur der Glaube auf die Couch. Hier wird auch dargelegt, warum jeder Fußballer nur mit Gehorsam erfolgreich wird, warum James Bond weder zur Ehe noch zum Zölibat fähig ist und dass bereits die alten Griechen wussten, wie der Mensch glücklich wird: Die Tugenden kehren zurück.
Seiten:
Raphael M. Bonelli
ISBN:978-3-86417-023-2
Seiten:
Normaler Preis
€16,80 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€16,80 EUR
Stückpreis
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
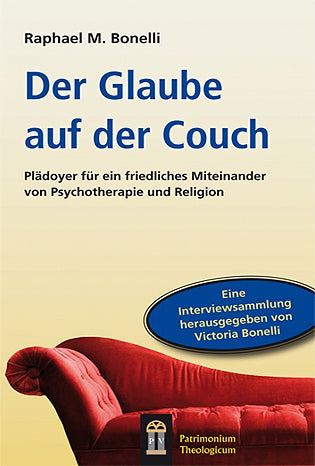

Raphael M. Bonelli
Leseprobe
 NEWSLETTER
NEWSLETTER
 KONTAKT
KONTAKT


