Elisabeth Escher
Der letzte Akt vom Puppenspiel
Der letzte Akt vom Puppenspiel
Hildegard Glas ist vierundneunzig Jahre alt und lebt nach dem Tod ihres Ehemanns weiterhin in ihrem Haus am Stadtrand von Salzburg. Körperlich gebrechlich aber geistig nach wie vor rege, gängelt und manipuliert sie gekonnt die Menschen um sich herum. Ihr Sohn Wieland, erfolgreicher Jurist im Ruhestand, die Pflegerin Anyana, die Hildegard rund um die Uhr betreut und bei ihr im Haus wohnt, ihre einstige Zugehfrau Rosi und auch die Enkeltochter Jenni, die in Rom studiert und sich in unglücklichen Beziehungen mit verheirateten Männern verstrickt – sie alle tanzen nach ihrer Pfeife, als wäre sie die Puppenspielerin in ihrem ganz persönlichen Bühnenstück.
Als ein unerwarteter Brief eintrifft kommt Hildegards Souveränität schließlich ins Wanken, denn eine folgenschwere Lebenslüge drängt ans Licht und macht den letzten Akt ihres Puppenspiels zu einer Gratwanderung.
Als ein unerwarteter Brief eintrifft kommt Hildegards Souveränität schließlich ins Wanken, denn eine folgenschwere Lebenslüge drängt ans Licht und macht den letzten Akt ihres Puppenspiels zu einer Gratwanderung.
Seiten: 220
Elisabeth Escher
ISBN:978-3-96123-078-5
Seiten: 220
Normaler Preis
€15,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€15,00 EUR
Stückpreis
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
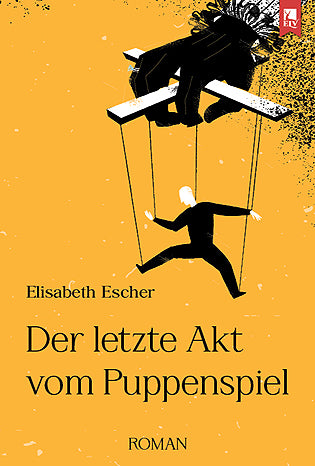

Elisabeth Escher
Leseprobe
 NEWSLETTER
NEWSLETTER
 KONTAKT
KONTAKT


