Wilhelm Imkamp
Geradeaus quergedacht
Geradeaus quergedacht
Ist die Marienverehrung heute noch zeitgemäß? Sollte Liturgie auch ein ästhetisches Erlebnis sein? Und was genau ist eigentlich »Clerical Correctness«? Diese und viele weitere Fragen zu den Themen Glaube, Kirche und Gesellschaft erörterte Prälat Dr. Wilhelm Imkamp in den vergangenen Jahrzehnten in zahlreichen Interviews, von denen einige aus dem Zeitraum von 1988 bis 2016 nun erstmals in einem Band vorliegen.
Diskutiert werden unter anderem die Marienerscheinungen in Fatima, die abnehmende Zahl der Gläubigen in den Kirchen, die äußere Erscheinung von Priestern und das aktuelle politische Tagesgeschehen. In den Mittelpunkt rückt in den Gesprächen auch immer wieder der Wallfahrtsort Maria Vesperbild, wo Prälat Imkamp seit 1988 als Wallfahrtsdirektor wirkt. In gewohnt lebendiger, direkter Art bezeichnet er Maria Vesperbild als »religiöses Dienstleistungsunternehmen«, das die Freude am Glauben erlebbar macht.
Diskutiert werden unter anderem die Marienerscheinungen in Fatima, die abnehmende Zahl der Gläubigen in den Kirchen, die äußere Erscheinung von Priestern und das aktuelle politische Tagesgeschehen. In den Mittelpunkt rückt in den Gesprächen auch immer wieder der Wallfahrtsort Maria Vesperbild, wo Prälat Imkamp seit 1988 als Wallfahrtsdirektor wirkt. In gewohnt lebendiger, direkter Art bezeichnet er Maria Vesperbild als »religiöses Dienstleistungsunternehmen«, das die Freude am Glauben erlebbar macht.
Seiten: 144
Wilhelm Imkamp
ISBN:978-3-8107-0259-3
Seiten: 144
Normaler Preis
€11,80 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€11,80 EUR
Stückpreis
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
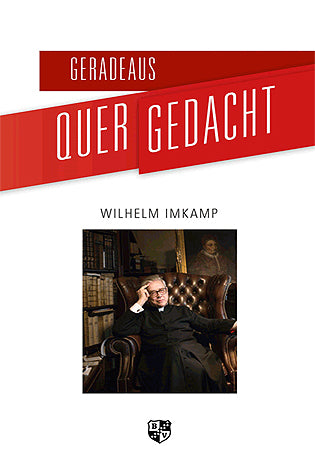
Wilhelm Imkamp
Leseprobe
 NEWSLETTER
NEWSLETTER
 KONTAKT
KONTAKT


