Sebastian Moll
Theologische Denkfehler
Theologische Denkfehler
Warum Vertrauen gut, aber Verstehen noch besser ist, warum Kompromisse in theologischen Fragen nicht funktionieren und weshalb politische Korrektheit nichts mit Anstand zu tun hat – diese und viele andere weit verbreitete Irrtümer und theologische Denkfehler greift Sebastian Moll in seinen 25 in diesem Band erstmals gesammelten Artikeln aus der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost auf.
Entstanden ist ein knappes aber treffendes Kompendium mit Richtigstellungen theologisch-philosophischer Allgemeinplätze, gar »gottloser Dämlichkeiten«, wie es der Autor überspitzt auf den Punkt bringt.
Eine Pflichtlektüre für theologisch Interessierte!
Seiten: 108
Sebastian Moll
ISBN:978-3-8107-0358-3
Seiten: 108
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
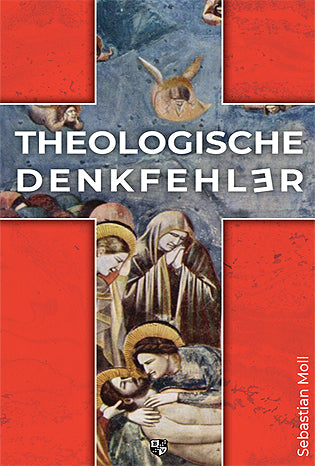
Sebastian Moll
Leseprobe
 NEWSLETTER
NEWSLETTER
 KONTAKT
KONTAKT


